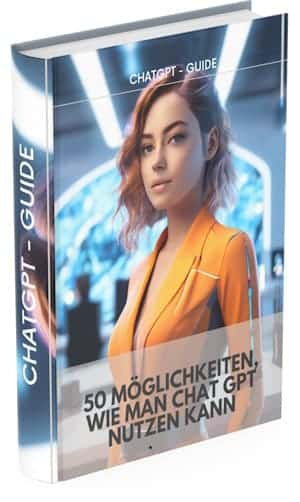Kanton Zürich / Wirtschaft
Sie finden im Kanton Zürich Wirtschaft die gesammelten Daten über Verkehr und Wirtschaft im Kanton Zürich
Kanton Zürich Wirtschaft / Autobahn
A1…….St. Margrethen (SG) – St. Gallen (SG) – Zürich – Bern (BE) – Yverdon (VD) – Genf (GE)
…………Länge 410 km • Anteil ZH: Hagenbuch – Zürich – Dietikon
N1…….St. Margrethen (SG) – .. – Genf (GE) – Bardonnex (GE)
A1L…..Zürich Ost – Zürich Unterstrass – Zürich Letten • Länge 2 km
A1H…..Limmattalerkreuz – Zürich Hardturm
A3…….Basel (BS) – Frick (AG) – Zürich – Pfäffikon (SZ) – Sargans (SG)
…………Länge 180 km ″ Anteil ZH: Dietikon – Zürich – Richterswil
N3…….Kannenfeld – Basel – .. – Sargans (SG)
A3W….Zürich Brunau – Zürich Wiedikon • Betrieb 2009
A4…….Schaffhausen (SH) – Flurlingen – Winterthur – Zürich – Cham (ZG) – Brunnen (SZ)
………..Länge 165 km • Anteil ZH: Flurlingen – Zürich – Knonau • Betrieb 2009
N4…….Bargen (SH) – Schaffhausen (SH) – .. – Brunnen (SZ) – Altdorf (UR)
A7…….Kreuzlingen (TG) – Frauenfeld (TG) – Winterthur Ost
………..Länge 35 km • Anteil ZH: Kefikon – Winterthur Ost
A50…..Zweidlen – Glattfelden – Kreuzstrasse
A51…..Zürich Nord – Flughafen Kloten – Bülach Nord
A52…..Zürich – Zumikon – Forch – Hinwil A53
A53…..Verzweigung Reichenburg A3 (SZ) – Uznach (SG) – Rüti – Hinwil – Uster – Verzweigung Brüttisellen A1
…………Länge _ km • Anteil ZH: Rüti – Verzweigung Brüttisellen A1
Kanton Zürich Wirtschaft / Autogeschichte
Bis 1927 durfte man im Kanton ZH sonntags nur mit höchstens 25 km/h autofahren
Kanton Zürich Wirtschaft / Eisenbahn
Eisenbahnlinien Zürich - Aargau
SBB….Zürich HB – Lenzburg (AG) – Aarau (AG) – Bern (BE)
………..Anteil ZH: Zürich HB – Dietikon
S3…….Wetzikon – Effretikon – Zürich HB – Dietikon – Lenzburg (AG) – Aarau (AG)
SBB….Zürich HB – Baden (AG) – Aarau (AG) – Bern (BE)
………..Anteil ZH: Zürich HB – Dietikon
S6…….Uetikon – Zürich HB – Oerlikon – Regensdorf/Watt – Baden (AG)
S12…..Seuzach/Seen – Winterthur – Zürich HB – Dietikon – Baden (AG) – Brugg (AG)
S21…..Zürich HB – Oerlikon – Regensdorf/Watt
S17…..Dietikon – Bremgarten (AG) – Wohlen (AG)
Eisenbahnlinien Knonaueramt - Zürich Oberland
S5…….Zug (ZG) – Affoltern a.A. – Zürich HB – Uster – Rapperswil (SG) – Pfäffikon (SZ)
S14…..Affoltern a.A. – Zürich HB – Oerlikon – Uster – Hinwil
S18…..Forchbahn • Stadelhofen – Forch – Esslingen
Eisenbahnlinien Zürich Unterland - Zürich Oberland
SBB….Zürich – Bülach – Rafz – Schaffhausen (SH)
S9…….Uster – Dübendorf – Zürich HB – Rafz – Schaffhausen (SH)
S15…..Pfäffikon (SZ) – Rapperswil (SG) – Uster – Zürich HB – Oerlikon – Niederweningen
S19…..Pfäffikon (ZH) – Effretikon – Oerlikon – Zürich HB – Dietikon – Baden (AG) – Turgi (AG)
Eisenbahnlinien Zürich - St. Gallen
SBB….Zürich HB – Winterthur – St. Gallen (SG)
S35…..Winterthur – Wil (SG)
Eisenbahnlinien Zürichsee - Winterthur
SBB….Zürich HB – Zürich Flughafen – Winterthur – Frauenfeld (TG)
S11…..Hardbrücke – Zürich HB – Winterthur
S23…..Zürich HB – Winterthur
S7…….Rapperswil (SG) – Meilen – Zürich HB – Oerlikon – Kloten – Winterthur
S16…..Meilen – Zürich HB – Zürich Flughafen
S8…….Pfäffikon (SZ) – Thalwil – Zürich HB – Wallisellen – Winterthur – Weinfelden (TG)
Eisenbahnlinien Winterthur
S26…..Winterthur – Bauma – Rüti
S29…..Winterthur – Seuzach – Stammheim – Stein am Rhein (SH)
S30…..Winterthur – Frauenfeld – Weinfelden (TG)
S33…..Winterthur – Andelfingen – Schaffhausen (SH)
S35…..Winterthur – Wil (SG)
S41…..Winterthur – Bülach – Eglisau – Bad Zurzach (AG) – Waldshut [D] • Linie seit 1876
Eisenbahnlinien Zürich - Schwyz (March+Höfe)
SBB….Zürich HB – Ziegelbrücke (GL) – Sargans (SG) – Chur (GR) • Betrieb 1875
S2…….Zürich Flughafen – Zürich HB – Pfäffikon (SZ) – Ziegelbrücke (GL)
S8…….Pfäffikon (SZ) – Thalwil – Zürich HB – Wallisellen – Winterthur – Weinfelden (TG)
S25…..Glarner Sprinter • Zürich HB – Pfäffikon (SZ) – Ziegelbrücke (GL) – Linthal (GL)
Eisenbahnlinien Zürich - Zentralschweiz
SBB….Zürich HB – Zug (ZG) – Luzern (LU) • Betrieb ZH-ZG: 1897, ZG-LU: 1864
…………Anteil ZH: Zürich HB – Sihlbrugg
S24…..Thayngen (SH) – Schaffhausen (SH) – Winterthur – Zürich Flughafen – Zürich HB – Zürich Enge – Sihlbrugg – Zug (ZG)
S4…….Zürich HB – Brunau – Sihlwald (SZU) • Länge 14 km
S13…..Wädenswil – Biberbrugg (SZ) – Einsiedeln /SZ)
S40…..Rapperswil – Pfäffikon (SZ) – Einsiedeln (SZ)
Kanton Zürich Wirtschaft / Eisenbahnbauwerk
Durchmesserlinie
Die 9,6 km lange Durchmesserlinie durchquert seit 2015 die Stadt Zürich von Altstetten über den Hauptbahnhof bis nach Oerlikon in einem grossen Bogen • die Linie führt von Altstetten auf Brücken (Kohlendreieckbrücke mit Länge 394 m, Letzigrabenbrücke mit Länge 1’156 m) bis zum unterirdischen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse • und von hier seit 2014 durch den 4,8 km langen Weinbergtunnel nach Oerlikon • sie unterquert die beiden Zürcher Flüsse Sihl und Limmat und bildet einen zentralen Teil der West-Ost-Achse des nationalen Schienennetzes
Zürichbergtunnel
Strecke: Stadelhofen – Stettbach • Einspurig • Länge 5,015 km • Scheitelhöhe _ müM • Betrieb 1990
Betriebszentralen
Beim Standort Zürich-Flughafen befindet sich eine der 4 Betriebszentralen (BZ Ost) der SBB • weitere Betriebszentralen sind in Olten (BZ Mitte), in Lausanne (BZ West) und in Pollegio (BZ Süd) • die BLS Lötschbergbahn hat eine eigene Betriebszentrale in Spiez
Kanton Zürich Wirtschaft / Eisenbahngeschichte
Spanisch-Brötli-Bahn
Die erste in Zürich gegründete Bahngesellschaft plante eine Verbindung Zürich – Baden – Waldshut – Rheintal – Basel, um dem Zürcher Handel die Anbindung an das Eisenbahnnetz in Deutschland zu schaffen • 1847 baute die Nordbahngesellschaft den Kopfbahnhof Zürich, damals ausserhalb der Stadt fast auf der grünen Wiese • und konnte im gleichen Jahr die Strecke Zürich – Baden (AG) dem Betrieb übergeben • weil der Morgenzug von Baden die Bäckereispezialität sogenannt «spanischer» Brötchen nach Zürich zum Verkauf brachte, taufte der Volksmund dieses erste Bähnchen «Spanisch-Brötli-Bahn»
Glatttalbahn
Ab 1856 fuhr die erste Glatttalbahn von Wallisellen nach Uster • 1858 wurde die Strecke bis Wetzikon verlängert • ab 1859 verband die Glatttallinie Rapperswil über Wetzikon und Uster mit dem Zürcher Hauptbahnhof
Bahnlinie Zürich - Luzern
1864-97 führte die Eisenbahnstrecke Zürich – Luzern durch das Knonaueramt • bis 1897 die Neubaustrecke von Thalwil über das Sihltal nach dem Zimmerbergdurchstich den Betrieb aufnahm • diese Strecke wurde ab 1897 zum Gotthardbahn-Zubringer
Nordostbahn
1875 eröffnete die NOB die linksufrige Bahnstrecke vom Zürcher Hauptbahnhof nach Thalwil – Pfäffikon (SZ) – Ziegelbrücke (GL) – Näfels (GL)
Oberlandbahn
1876 war die Strecke Rüti – Wald fertiggestellt
Zürichseelinie
Ab 1894 fuhr der Zug am rechten Zürichseeufer von Rapperswil (SG) – Zürich Stadelhofen
Uerikon-Bauma-Bahn
Von 1901-49 sorgte die UeBB für den Seeanschluss des Zürcher Oberlandes
S-Bahn Zürich
In Zürich fuhr die erste S-Bahn Komposition 1991 • Initiator war der damalige Zürcher Regierungsrat Hans Künzi • er gilt auch als Promoter des Zürcher Verkehrsverbundes ZVV
Museumsbahn
Museumsbahn DVZO / Museumsbahn • Strecke: Bauma – Bäretswil – Hinwil • seit 1978 • Länge 12 km
Hinweis Die SBB haben 1969 den Personenverkehr auf der Teilstrecke Hinwil – Bauma, der ehemaligen Uerikon-Bauma-Bahn eingestellt • im gleichen Jahr gründeten Eisenbahnenthusiasten den Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) • dieser betreibt seit 1978 mit seinen historischen Zügen auf der Strecke Hinwil – Bauma fahrplanmässige Museumsfahrten • seit 2000 ist der DVZO Eigentümer der 6 km langen Teilstrecke Bauma – Bäretswil • der DVZO ist ein konzessioniertes Eisenbahn-Verkehrsunternehmen und besitzt die Lizenz für die Organisation von Extrazügen in der ganzen Schweiz • alle Züge führen einen Buffetwagen mit
Zürcher Museumsbahn ZMB
Strecke Sihlwald – Wiedikon – Sihlbrugg – Sihlwald • seit 1996 • Länge 19 km
Hinweis Historischer Zug mit Schnaaggi-Schaaggi, der über 100jährigen Dampflok Typ E 3/3

picswiss.ch/Roland Zumbühl
Kanton Zürich Wirtschaft / Bergbahn
Kanton Zürich Wirtschaft / Eisenbahn
Uetlibergbahn / Strecke: Zürich – Üetliberg (SZU, S10) • Zürich HB – Uetliberg Bergstation
Steilste Adhäsionsbahn Europas • Länge 10 km • Bergstation 813 müM
Dampfbetrieb 1875 • Elektrobetrieb 1923 • Seit 1922 Bahngesellschaft Zürich-Uetliberg
Kanton Zürich Wirtschaft / Zahnradbahn
Dolderbahn / Strecke: Römerhof – Dolder • System Strub • Länge 1’328 m • Bergstation 605 müM • Max. Steigung 196 %o • Fahrzeit 5,6 min • Betrieb Standseilbahn 1895 • Betrieb Zahnradbahn 1973
Kanton Zürich Wirtschaft / Standseilbahn
Rigiblickbahn / Strecke: Rigi-Platz – Rigiblick • Betrieb 1901 bis Germaniastrasse • Betrieb 1979 bis Freudenbergstrasse • 2025 Erneuerung
Schmalspur 1’000 mm • Kabinen 2x30er • Länge 385 m • Bergstation 583 müM • Max. Steigung 360 %o • Fahrzeit 2 min
UBS Polybahn / Strecke: Centralplatz – Polyterrasse ETH • Schmalspur 955 mm • Kabinen 2x50er • Länge 176 m • Mittl. Steigung 230 %o • Fahrzeit 100 s • Wasserbetrieb 1889 • Elektrobetrieb 1897
Kanton Zürich Wirtschaft / Luftseilbahn
Züri-Bahn / 3Seil Umlaufbahn • Kabinen 18x24er • Länge _ m • Betrieb 2020
Portal-Seilbahn über Zürichsee • Mythenquai – Zürichhorn • Bauherr: ZKB zu ihrem 150Jahr-Jubiläum
Adliswil – Felsenegg (LAF) / Kabinen 2x30er • Länge 1’048 m • Bergstation 804 müM • Betrieb 1954
Kanton Zürich Wirtschaft / Schiff
Kanton Zürich Wirtschaft / Fähren
Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy AG
Fähre: Ellikon (Marthalen) – Nack (Lottstetten, [D])
Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy AG
Fähre: Tössegg – Buchberg
Zürichsee Fähre Horgen-Meilen AG (FHM)
Fähre: Horgen – Meilen
Flotte Motorschiffe: Schwan (1969), Meilen (1979), Horgen (1991), Zürichsee (1999), Burg (2003)
Kanton Zürich Wirtschaft / Rheinschifffahrt
Rheinschifffahrt Wirth • Gegründet 1936
Stationen: Eglisau, Ellikon, Kaiserstuhl, Rheinau, Rheinfall, Rheinsfelden, Rekingen, Rüdlingen, Tössegg
Angebot: Rundfahrten, Gesellschaftsfahrten, Bootsfahrschule, Bootsvermietung
Flotte Motorschiff: Rhenania
Flotte Weidlinge: Biber, Möve
Schifffahrtsbetrieb Schiffmändli
Stationen: Eglisau, Ellikon, Flaach, Rheinau, Rüdlingen, Schloss Laufen, Schlössli Wörth, Tössegg
Angebot: Extrafahrten, Rundfahrten, Themenfahrten
Flotte Motorschiff: 6 Kombimotorboote, Kabinenschiff ‚Rhyfall‘
Schifffahrtsgesellschaft Züri-Rhy AG (SZR)
Stationen: Eglisau, Ellikon, Rheinsfelden, Rüdlingen, Tössegg
Angebot: Kursfahrten, Rundfahrten, Themenfahrten, Schiffsmiete
Flotte Motorschiffe: Flipper, Hecht, Nautilus, Neptun, Rhenus, Rhystern
Kanton Zürich Wirtschaft / Seeschifffahrt
Genossenschaft MS Etzel • Gegründet 2001
Angebot: Charterfahrten, Rundfahrten
Flotte Motorschiff: Etzel (1934) • die Maschinenfabrik Escher Wyss & Cie konzipierte hier den ersten Kaplan-Verstellpropeller weltweit
Schifffahrts-Genossenschaft Greifensee (SGG) • Gegründet 1890
Stationen: Fällanden, Greifensee, Maur, Mönchaltorf Aaspitz, Niederuster
Angebot: Kursfahrten Maur – Niederuster, Rundfahrten, Charterfahrten, Themenfahrten
Flotte Dampfschiff: Greif (1895) • ältestes und einziges mit Schraubenantrieb betriebenes Dampfschiff der Schweiz
Flotte Motorschiffe: Heimat (1933), Stadt Uster (1995), David Herrliberger (2006)
Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft AG (ZSG) • Gegründet 1957
Stationen: Erlenbach, Feldmeilen, Halbinsel Au, Herrliberg, Horgen, Kilchberg, Bendlikon, Küsnacht, Küsnacht Heslibach, Insel Ufenau (SZ), Männedorf, Meilen, Oberrieden, Rapperswil (SG), Richterswil, Rüschlikon, Stäfa, Thalwil, Uerikon, Uetikon,Wädenswil, Zollikon Gstad, Zürich Bürkliplatz, Zürichhorn Casino, Zürich Wollishofen
Angebot: Kursfahrten, Rundfahrten, Themenfahrten, Schiffsmiete
Flotte Dampfschiffe: Stadt Zürich (1909), Stadt Rapperswil (1914)
Flotte Motorschiffe: Linth (1952), Säntis (1957), Limmat (1958), Bachtel 1962), Helvetia (1964), Wädenswil (1968), Forch (2001), Zimmerberg (2001), Panta Rhei (2007)
Flotte Panoramaschiffe: Albis (1997), Pfannenstiel (1998), Üetliberg (1999)
Flotte Limmatboote: Felix (1992), Regula (1992), Turicum (1993)
Kanton Zürich Wirtschaft / Schifffahrtsgeschichte
1805 wurde das letzte Kriegsschiff auf dem Zürichsee aus dem Betrieb genommen • dessen letzter Kampf ging gegen die Rapperswiler
1835 fuhr das erste Dampfschiff auf dem Zürichsee
Kanton Zürich Wirtschaft / Flugplatz
Dübendorf
Flugplatz • Höhe 448 müM • ICAO-Code LSMD • Lage: Überlandstrasse • Betrieb 1910
Militärflugplatz • Heliport • Höhe 448 müM • ICAO-Code LSMD • Lage: Überlandstrasse • Betrieb 1910
Dürnten / Flugfeld • Höhe 770 müM • ICAO-Code LSPK • Betrieb 1947 • Lage: Hasenstrick
Fehraltorf / Flugfeld • Höhe 536 müM • ICAO-Code LSZK • Betrieb 1953 • Lage: Speck
Hausen a.A. / Flugfeld • Höhe 588 müM • ICAO-Code LSZN
Kloten / Flughafen Interkontinental • Höhe 432 müM • ICAO-Code LSZH • IATA-Code ZRH • Betrieb 1948
Winterthur / Flugfeld • Höhe 456 müM • ICAO-Code LSPH • Betrieb 1964 • Lage: Hegmatten
Kanton Zürich Wirtschaft / Luftfahrtgeschichte
Erste schweizerische Fluglinie 1919: Zürich – Genf
Erste internationale Fluglinie der Schweiz 1922: Genf – Zürich – Nürnberg [D]
Gründung der Luftfahrtgesellschaft ‚Swissair‘ 1931 • Liquidation 2002
Kanton Zürich Wirtschaft / Handwerk
Weinreben
Aus einer Schenkungsurkunde von 834 geht hervor, dass im Stammertal bereits damals Weinreben angepflanzt wurden / eine Privatperson vermachte nämlich dem Kloster St. Gallen seine Weinberge / die Reben waren aus Kleven (Chiavenna [I]) eingeführt und hiessen deshalb Klevner, wie der Wein heute / aus den anfänglich recht sauren Tropfen entwickelte sich bis heute ein köstlicher Trunk
Ebenfalls aus Urkunden geht hervor, dass im 10. Jh. auch am Sonnenhang des Zürichsees Reben gezogen wurden / der anfänglich saure Wein ist durch stetige Veredelung der Reben zu einem Qualitätsprodukt herangewachsen / die Krümmung des Zürichsees gleicht einer auf die Erde verlegten Sonnenuhr / die direkte Sonneneinstrahlung und die Abstrahlung des Sees auf den Südhang haben einen ausserordentlich günstigen Einfluss auf die Weinberge
Saumweg
Mit der Eröffnung der Schöllenen Anfang des 13. Jh. führte 1230-1830 die wichtigste Verbindung von Norden nach Süden über den Zürichsee nach Horgen und auf dem Saumweg über den Hirzel in die Zentralschweiz / dies bedeutete florierendes Gewerbe und Zuwachs der Bevölkerung in den anliegenden Orten
In Zürich fingen Locarneser Protestanten, die zur Zeit der Gegenreformation Mitte des 16. Jh. als Glaubensflüchtlinge eingewandert waren und Namen wie Orelli, Pestalozzi und Muralt trugen, mit dem Seiden- und Baumwollgewerbe an / die Produkte verkauften sie dank ihren alten Beziehungen nach Oberitalien
Strohflechterei
Sie war im 17.-18. Jh. für die Bauern im Rafzerfeld ein willkommener Nebenverdienst / 1880 führte Heinrich Ritz die Strohhutmaschine ein, baute seine Heimindustrie zur Fabrik aus und pflegte Verbindungen zu vielen europäischen Modezentren / Modeströmungen beeinflussten aber den Absatz der Hüte negativ und die Schliessung des Unternehmens im Jahre 1956 war die Folge davon
Baumwolle
Die im 18. Jh. dominierende Landwirtschaft im Zürcher Oberland, im Knonaueramt und an den Ufern des Zürichsees nahm mit der Verbreitung der Baumwollspinnerei und Baumwollweberei Mitte des 18. Jh. zunehmend ab / die Bauern auf den vielen Kleinhöfen waren auf einen Nebenverdienst angewiesen / bei der Herstellung von Textilien, beim Spinnen und Weben konnte sich die ganze Familie beteiligen
Baumwollstoff wurde zunächst in der Verlagsproduktion hergestellt / der Fabrikant besorgte die Rohmaterialien in den Hafenstädten Europas / Heimarbeiterfamilien spannen und woben in ihren Stuben zu Hause / weil es für den Händler zu umständlich war, alle Heimwerker, meist Bauern selbst zu besuchen, schaltete er einen Verleger ein / dieser organisierte die Arbeit der Heimarbeiter und brachte die Rohmaterialien entweder selbst oder durch einen nochmaligen Zwischenträger, den Fergger ins Dorf und holte die Produkte wieder ab / der Verleger als Vorstufe des Fabrikanten sorgte oftmals auch für die Weiterverarbeitung / das gesponnene Garn kam zum Weber / der gewobene Stoff allenfalls zum Färber oder Drucker / der Fabrikant nahm das Endprodukt gegen Bezahlung entgegen und verkaufte es weiter, meist ins Ausland
Kanton Zürich Wirtschaft / Industrie
Mechanisierung
Die Baumwollproduktion gehörte im 18. Jh. zu den wichtigsten Industriezweigen im Kt. Zürich / dies führte zu einem bescheidenen Wohlstand bis die mechanischen Webstühle in den Fabriken des Unterlandes der Heimarbeit ein Ende setzten / schon vor dem Einbruch der französischen Armeen in die alte Eidgenossenschaft 1798 begann das maschinengesponnene englische Baumwollgarn das handgesponnene schweizerische zu konkurrenzieren und die Preise zu unterbieten
England erlebte die industrielle Umwälzung mit der Einführung der Spinn- und Webmaschinen in den 1760er Jahren / der britische Handweber James Hargreaves erfand 1764 die Baumwollspinnmaschine / dadurch entstand ein harter Preisdruck und erzwang auch im Kt. Zürich eine Mechanisierung / die erste mechanische Spinnerei der Schweiz entstand 1801 in St. Gallen / auch im Kt. Zürich entstanden Anfang 19. Jh. die ersten Baumwollspinnereien / die Fabriken wurden wegen der Turbinen in der Nähe von Flüssen angesiedelt / davon entlegene Orte konnten nicht profitieren
Durch die Mechanisierung in der Textilindustrie verloren Tausende von Heimarbeitsbeschäftigten ihren Erwerb oder sie wurden Fabrikarbeiter / doch die soziale Umstrukturierung hat Folgen / die Unzufriedenheit entlud sich beim Brand von Uster im November 1832 / Heimweber aus dem Zürcher Oberland zogen nach Uster / sie protestierten dagegen, dass die Zürcher Regierung kein Verbot für Webstühle in die Verfassung schrieb / die aufgebrachten Heimweber stürmten die erste mechanische Spinnerei & Weberei in der Region, die Fabrik Corrodi & Pfister in Oberuster und zündeten sie an / dieser Proteststurm ging als ‚Usterbrand‘ in die Schweizer Geschichte ein / trotzdem ging die Entwicklung weiter / es entstanden Industriestandorte mit Fabrikbauten, Nebengebäuden, Fabrikantenvillen mit Park und Kosthäusern für die Arbeiterschaft
Gemeinsames Merkmal aller Baumwollunternehmen im Kt. Zürich war der kurze Bestand ihrer Fabriken / von den bis 1831 gegründeten 280 Firmen im Kanton überlebten nur 30 % / intensiver Wettbewerb, technischer Fortschritt und ein erhöhter Energiebedarf führten zu einer unbarmherzigen Selektion / erst mit der Ansiedlung der Maschinenindustrie als Zulieferant für die Textilbranche Mitte des 19. Jh. begann wieder Wohlstand Einzug zu halten
Seidenindustrie
Anders als in der Baumwollverarbeitung verblieb in der Seidenindustrie die Produktion bis in die 2. Hälfte des 19. Jh. weitgehend in der Heimarbeit mit dem Handwebstuhl / 1861 kam im Kt. Zürich der erste mechanische Seidenwebstuhl in den Verkauf / als die Baumwollfabrikation bereits im Abstieg lag, blühte die Seidenfabrikation hingegen immer noch / der Erfolg der Zürcher Seide lag in der guten Qualität der Textilien und in den wegen der billigen Arbeitskräfte tiefen Preisen / trotzdem bildete die Seidenweberei für viele Bauernfamilien oft die letzte Möglichkeit, sich mit einem Zusatzverdienst über Wasser zu halten / um die Jahrhundertwende aber begann der Niedergang auch in der Seidenindustrie
Maschinenindustrie
Anfang des 19. Jh. gründeten einige Leute Maschinenspinnereien / unter anderem 1805 die Escher Wyss & Co. in Zürich / all diese kleinen Betriebe importierten Maschinen aus dem Ausland / nur Escher Wyss baute in der zur Spinnerei gehörenden Werkstatt die Spinnmaschinen selber, indem sie die aus England stammenden Maschinen kopierten / weil Anfang des 19. Jh. eine Vielzahl mechanischer Spinnereien aus dem Boden schossen, wurde für Escher Wyss die Produktion von Spinnmaschinen plötzlich wichtiger und einträglicher als die Spinnerei / so entstand die erste schweizerische Maschinenfabrik
Die Maschinenindustrie in der Schweiz war ein Kind der Textilindustrie / denn es galt, der Konkurrenz des maschinengesponnenen englischen Baumwollgarns die Stirn zu bieten / der Import ausländischer Spinnmaschinen war teuer und schwierig / also begannen einzelne Firmen die Maschinen selber in Kopie der englischen Erfindungen zu konstruieren / während mehrerer Jz. blieb die inländische Textilindustrie der Hauptabnehmer der inzwischen entwickelten diversen Arten von Textilmaschinen
Johann Jakob und Salomon Sulzer gründeten, zusammen mit ihrem Vater 1834 im Tössfeld eine Eisengiesserei / sie war die Keimzelle der gesamten baulichen Entwicklung und ein wichtiger Zeitzeuge aus den Anfängen des später weltweit tätigen Konzerns / 1851 kam Charles Brown 24jährig in die Schweiz und hatte nach einer 6jährigen Ausbildung ebenfalls praktische Erfahrung im Dampfmaschinenbau / England war damals in praktisch allen technisch-industriellen Bereichen führend / Charles Brown machte aus der Sulzer’schen Giesserei und Kesselschmiede überhaupt erst eine Maschinenfabrik / er erfand die Ventildampfmaschine, die der zuvor international führenden Corliss-Maschine überlegen war / an der Weltausstellung 1867 in Paris erreichten die Gebr. Sulzer für diese Maschine den ersten Preis / dies verschaffte der Firma den eigentlichen Durchbruch zu internationalem Rang / als Brown die Gebr. Sulzer nach 20 Jahren verliess, war die Belegschaft auf 1’000 Mitarbeiter angewachsen
In der Folge baute er als Direktor 1871 die neugegründete Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik Winterthur auf / dort konstruierte er die erste Zahnradlokomotive für die erste Zahnradbahn in der Schweiz (Vitznau-Rigi-Bahn) / später gab er ein kurzes Gastspiel in der 1863 gegründeten Maschinenfabrik Oerlikon, die sein Sohn Charles Eugen Lancelot Brown zum Erfolg in der Elektrotechnik führte / der Sohn hatte am 1874 gegründeten Technikum Winterthur studiert / 1891 gründete Charles Brown mit Walter Boveri in Baden (AG) die neue Firma BBC Brown Boveri & Cie / und zwar mit dem Geld des Zürcher Seidenfabrikanten Conrad Baumann / dieser war der Schwiegervater von Walter Boveri
Die zunehmende Erweiterung des Aufgabenfeldes (Heizungsbau, Dieselmotoren, Schiffsbau) und der wachsende Erfolg der Gebr. Sulzer führten in den folgenden Jahrzehnten zum Bau zahlreicher Industriegebäude / so übertraf das Areal zusammen mit der benachbarten, 1871 gegründeten Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) schliesslich die Ausmasse der Altstadt / am Ende der 1980er Jahre verliess die Schwerindustrie das Sulzerareal / durch die Umnutzung von Industriebauten sowie zahlreiche Neubauten entstand ein neues Stadtquartier mit Wohnungen und Dienstleistungsbetrieben
Johann Jacob Rieter, 1762 geboren, fing mit Baumwoll- und Kolonialwarenhandel an / als der Siegeslauf der Spinnmaschinen einsetzte, fand er Baumwollgarn selber herzustellen profitabler als es zu kaufen / so entwickelte sich neben dem Handel die Spinnerei / der Sohn hielt es für klüger, die nötigen Maschinen für die Spinnerei in der Werkstätte selbst anzufertigen, als sie immer neu zu kaufen und dann doch reparieren zu müssen / als Nebenprodukt der Spinnerei begann er seine Maschinenfabrik / die 3. Generation gab das Spinnen auf und produzierte nur noch Maschinen / die Firma Rieter expandierte 1854 ihre industriellen Werkstätten in die Gebäude des 1233 gegründeten und später aufgegebenen Dominikanerinnenklosters / die Siedlungsentwicklung beschleunigte sich durch den Zustrom von immer neuen Arbeitern
Im Auftrag der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik SLM erbaute Ernst Jung 1872–73 an der Jägerstrasse nach englischem Vorbild 2 Reihen à 12 Arbeiterhäuschen mit Pflanzland / sie nahmen jeweils im Erdgeschoss Stube und Küche und im Dachgeschoss 2 Schlafkammern auf / bei den Häuserzeilen fielen jeweils die paarweise angeordneten Eingänge auf
Export
Weil der Inlandmarkt von vornherein zu klein war, suchten die Maschinenbauer ihre Absatzmärkte schon sehr früh jenseits der Grenze / als die ausländischen Maschinenhersteller mit grossen Serienfertigungen Bedeutung erlangten, hatten die Schweizer bereits ein Netz von Tochtergesellschaften, Verkaufsorganisationen und Vertretungen aufgebaut / auch besassen sie im Service sowie in der Nachbetreuung ihrer internationalen Kundschaft bereits ziemliche Erfahrung
Gegen Ende des 19. Jh. fing die Schweiz an, ganze Industrien zu exportieren / einerseits weil die europäischen und amerikanischen Länder je nach wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen Schutzzölle einführten / anderseits weil wegen der enormen industriellen Entwicklung die Arbeitskräfte knapp wurden / das trieb die Löhne empor und machte die billige Massenware in der Baumwoll- und Seidenindustrie zu teuer
Trotzdem wurden in der Schweiz immer noch beträchtliche Mengen an Baumwolle gesponnen und gewoben / dies erklärt sich einmal aus dem Bedarf der Stickereien, die eine fabelhafte Blüte erreichten und durch andere Veredlungsverfahren, die einen Qualitäts-Export ermöglichten / zum andern aus der Entwicklung einer bedeutenden Bekleidungsindustrie für den Inlandmarkt
Kieswerke
Im Rafzerfeld bei Hüntwangen werden heute die riesigen Schottermengen, die der Rheingletscher nach seinem Rückzug ablagerte, in Kieswerken abgebaut / durch die grossangelegten Kiesausbeutungen seit Anfang der 60er Jahre verliert die Landwirtschaft laufend an Gewicht