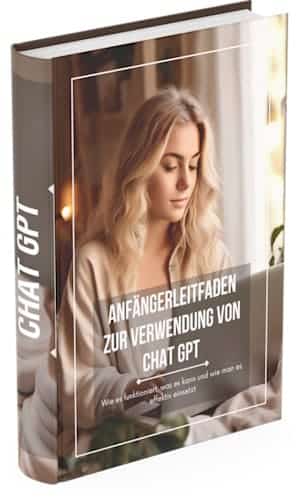Kanton St. Gallen / Topografie
Die St. Gallen Topografie reicht im Westen vom Oberen Zürichsee und Walensee bis zum Bodensee im Osten. Im Süden spannt er sich von der Linthebene über den Alpstein mit dem Säntis und das Seeztal ins Rheintal. Im Norden zieht er sich vom Toggenburg über die Stadt St. Gallen bis nach Rorschach. Eine Besonderheit: St. Gallen umschliesst beide Appenzell vollständig. In einem speziellen Kapitel erläutern wir zudem die Entstehung und Formung der Alpen.
Kanton St. Gallen Topografie / Tal
Talschaft / Anfang - Ende
Rheintal / Sargans – Bodensee
Seeztal / Sargans – Walenstadt
Taminatal / Bad Ragaz – Kunkelspass
♦ Calfeisental / Vättis – Sardonahütte
Kanton St. Gallen Topografie / Fluss
Fliessgewässer / Quelle - Mündung
Rhein / Tomasee (GR) – Basel (BS) • 375 km
…Anteil SG: _ – _ • _ km
♦ Thur / Säntis – Thurspitz (Gde Flaach) → [Rhein] • 134,6 km
…Anteil SG: Säntis – Bischofszell (TG) • 72 km
…• Necker / Ofenloch (Gde Nesslau) – Lütisburg → [Thur] • 32 km
…• Uze / Bichwil (Gde Uzwil) – Niederuzwil (Gde Uzwil) → [Thur] • 4,4 km
…• Glatt / Schwellbrunn – Niederuzwil (Gde Uzwil) → [Thur] • 24 km
…• Sitter / Weissbad (AI) – Bischofszell (TG) → [Thur] • 50 km
Linth / _ – Schmerikon → [Zürichsee] • 65,3 km
…Anteil SG: _ – Schmerikon → [Zürichsee] • 65,3 km
…• s / Sen – Obe (e) → [Linth] • _ km
Seerenbach / Flügespitz – Betlis (Gde Amden) → [Walensee] • _ km
Kanton St. Gallen Topografie / See
Kanton St. Gallen Topografie, Region St. Gallen / See
Stadt St. Gallen
Buebenweier / Gde St. Gallen • 775 müM • Fläche _ ha • Lage: Dreilinden • KO
Chrüzweier / Gde St. Gallen • 776 müM • Fläche _ ha • Lage: Dreilinden • KO
Mannenweier / Gde St. Gallen • 770 müM • Fläche _ ha • Lage: Dreilinden • KO
Wenigerweier / Gde St. Gallen • 838 müM • Fläche _ ha • Lage: Dreilinden • KO
Kanton St. Gallen Topografie, Region Wil / See
Hasenlooweiher / Gde Wil • 618 müM • Fläche _ ha • Lage: Rossrüti • KO
Stadtweiher / Gde Wil • 579 müM • Fläche _ ha • KO
Kanton St. Gallen Topografie, Region Toggenburg / See
Gräppelensee / Gde Wildhaus • _ müM
Schwendisee / Gde Wildhaus • 1’159 müM
Kanton St. Gallen Topografie, Region Linthebene / See
Walensee / Gde Walenstadt, Weesen-Amden • 419 müM • Fläche 24,1 km2 • KO 734.765/220.520
Zürichsee / Gde Schmerikon • 406 müM • Fläche 90,1 km2 • KO 691.603/234.802
Kanton St. Gallen Topografie, Region Oberland / See
Region Pizol
Schottensee / Gde Mels • 2’335 müM • Fläche __ km2
Wildsee / Gde Mels • 2’438 müM • Fläche __ km2
Baschalvasee / Wangs-Vilters • 2’174 müM • Fläche __ km2
Schwarzsee / Gde Wangs-Vilters • 2’372 müM • Fläche __ km2
Vilterser Seeli / Wangs-Vilters/Bad Ragaz • 1’898 müM • Fläche __ km2
Wangsersee / Wangs-Vilters/Bad Ragaz • 2’206 müM • Fläche __ km2
Kanton St. Gallen Topografie, Rheintal / See
Voralpsee / Gde Grabs • 1’123 müM • KO
Kanton St. Gallen Topografie / Stausee
Kanton St. Gallen Topografie, Region St. Gallen / Stausee
Gübsensee / Winkeln (Gde St. Gallen) • Gewichtsstaumauer H x L = 23,5 x 105 m
Betrieb 1900 • Fläche __ km2 • Niveau 682 müM • KO 741.500/251.500
Kanton St. Gallen Topografie, Region Toggenburg / Stausee
Kanton St. Gallen Topografie, Region Oberland / Stausee
Chapfensee / Gde Mels • Betrieb 1948
Gewichtsstaumauer Nord H x L = 20 x 125 m, Gewichtsstaumauer Ost H x L = 10 x 143 m
Fläche 11,2 km2 • Niveau 1’029 müM • KO 747.695/212.610
Gigerwaldsee / Gde Pfäfers • Bogenstaumauer H x L = 147 x 430 m
Betrieb 1976 • Fläche 71 ha • Niveau 1’335 müM • KO 747.367/197.712
Mapraggsee / Gde Pfäfers • Ausgleichsbecken
Betrieb 1976 • Fläche __ km2 • Niveau 865 müM • KO 755.310/201.010
Kanton St. Gallen Topografie / Berg
aa
Region _
Kanton St. Gallen Topografie, Berg / Toggenburg
Region Churfirsten
Selun • 2’205 müM
Frümsel • 2’263 müM
Brisi • 2’279 müM
Zuestollen • 2’235 müM
Schibenstoll • 2’234 müM
Hinterrugg • 2’306 müM
Chäserrugg • 2’262 müM
Kanton St. Gallen Topografie / Pass
Kanton St. Gallen Topografie / Passstrasse
Kanton St. Gallen, Region Toggenburg (Auto)
Hulftegg / Mühlrüti (Gde Mosnang) – Steg (Gde Fischenthal, ZH) • 943 müM • Restaurant
Oberricken / St. Gallenkappel – Wattwil • 906 müM
Ricken / Kaltbrunn – Wattwil • 795 müM • Restaurant
Wasserfluh / Lichtensteig – Brunnadern • 843 müM
Wildhaus / Neu St. Johann (Nesslau) – Gams • 1’090 müM
Schönau / Hemberg – Urnäsch (AR) • 1’066 müM
Schwägalp-Pass / Neu St. Johann (Gde Nesslau) – Urnäsch (AR) • 1’278 müM
Kanton St. Gallen, Region Linthebene (Auto)
Vorder Höhi / Amden – Starkenbach • 1’533 müM
Kanton St. Gallen, Region Oberland (Auto)
Kunkels / Vättis (Gde Pfäfers) – Tamins (GR) • 1’358 müM • KO 750.400/191.280 • Restaurant
Kanton St. Gallen, Region Rheintal (Auto)
Kanton St. Gallen Topografie / Fussweg
Kanton St. Gallen, Region Toggenburg (Fuss)
Chräzerenpass / Schwägalp-Passhöhe – Urnäsch/Toggenburg (SG) • 1’267 müM • KO 740.391/235.664
Rotsteinpass / Thurwies (Gde Wildhaus) – Meglisalp (Bzk Schwende, AI) • 2’119 müM • KO 745.853/234.268 • Berghaus
Kanton St. Gallen, Region Linthebene (Fuss)
Kleine Scheidegg / Grindelwald – Lauterbrunnen • __ müM • KO
Rengglipass / Wilderswil – Suld (Suldtal) • __ müM • KO
Sätteli / Tällihütte (Gadmertal) – Engstlenalp • __ müM • KO
Kanton St. Gallen, Region Oberland (Fuss)
Kunkelspass / Bad Ragaz – Bonaduz (GR) • 1’357 müM • Restaurant
Kanton St. Gallen, Rheintal (Fuss)
Foopass / Weisstannental – Elm (GL) • 2’222 müM • KO 737.003/200.650 • Bergweg
Heidelpass / Weisstannental – Calfeisental • 2’387 müM • KO 744.117/201.135 • Bergweg
Heubützlipass / Weisstannental – Calfeisental • 2’467 müM • KO 741.607/200.619 • Bergweg
Risetenpass / Weisstannental – Chrauchtal (GL) • 2’187 müM • KO 737.544/204.586 • Bergweg
Hahnenmoospass / Adelboden – Lenk • __ müM • KO
Kanton St. Gallen Topografie / Terra mirabilis
Kanton St. Gallen Topografie / Höhle
Region Rheintal / Höhle
Oberriet / Kristallhöhle • Lage: Kobelwald
Region See-Gaster / Höhle
Betlis (Gde Amden) / Rinquelle mit dahinter liegender Wasserhöhle • _ km erforscht
Region Toggenburg / Höhle
Wildhaus-Alt St. Johann / Wildenmannlisloch • Länge 192 m • davon vermessen 150 m • 1’635 müM • Lage: Nordhang des Selun
Kanton St. Gallen Topografie / Insel
aa
Kanton St. Gallen Topografie / Schlucht
Region St. Gallen / Schlucht
St. Gallen / Mühlenenschlucht • Lage: _
St. Gallen / Sittertobel • Lage: Wolfganghof (St. Gallen) – _
Region Toggenburg / Schlucht
Wattwil / Äulischlucht • Strecke: Unterplatten (Gde Wattwil – Hintergurtberg (Gde Wattwil
Wildhaus / Fürentobel • Länge _ km
Region Oberland / Schlucht
Bad Ragaz / Taminaschlucht • Länge 750 m • Tiefe 70 m • Lage: Altes Bad Pfäffers
Walenstadt / Schattenbach-Schlucht • Lage:
Kanton St. Gallen Topografie / Schutzgebiet
Region St. Gallen / Schutzgebiet
Winkeln (Gde St. Gallen) / Gübsensee • Naturschutz für See und umliegendes Ufergelände • Vogelparadies • seit • seit _ • Fläche _ km2
Region Linthebene / Schutzgebiet
Jona (Gde Rapperswil-Jona) / Joner Allmeind • Naturschutzgebiet • Fläche _ ha • KO
Region Oberland / Schutzgebiet
Tektonikarena Sardona • seit 2008 • Fläche 328 km2 • UNESCO Weltnaturerbe • grosse Dichte an Zeugen der Erdgeschichte (Geotope), vielfältige alpine Pflanzen- und Tierwelt sowie Hochmoore und Schwemmebenen • Lage: 13 Gemeinden in den Kantonen Glarus, Graubünden, St. Gallen
Region Rheintal / Schutzgebiet
Kanton St. Gallen Topografie / Wasserfall
Region Linthebene / Wasserfall
Betlis (Gde Amden) / Seerenbachfälle • 3 Kaskaden • Höhe 585 m • KO 731.102/222.430
Hinweis Oberste Kaskade Höhe 50 m • Mittlere Kaskade Höhe 305 m • Unterste Kaskade 190 m • Aussichtsplattform am Fusse der untersten Kaskade
Walenstadt / Berschnerfall • Höhe 46 m • Lage: Oberhalb Berschis
Region Sarganserland / Wasserfall
Mels
Guetental • Höhe _ m • Lage: Weisstannental
Isengrindfall • Höhe 230 m • Lage: Weisstannental
Lavtinabachfall • Höhe _ m • Lage: Weisstannental
Muttenbachfall • Höhe 45 m • Lage: Weisstannental
Piltschinabachfall • Höhe 81 m • Lage: Weisstannental
Sässbachfall • Höhe 86 m • Lage: Weisstannental
Region Toggenburg / Wasserfall
Unterwasser (Gde Wildhaus-Alt St. Johann) / Thurwasserfälle • 2 Kaskaden • Höhe 23 m • KO _
Oberer Thurfall 13 m • Unterer Thurfall 10 m
Wattwil / Krinauerbach-Wasserfall • Lage: Krinauerbach
Region Wil / Wasserfall
Uzwil / Felsegg-Wasserfall • Lage: Felsegg
Kanton St. Gallen Topografie / Klima
Die vom Atlantik her einströmenden Luftmassen sind feucht / wenn sie durch das Gebirge gehoben werden, kühlen sie sich ab / dabei steigt die relative Luftfeuchtigkeit / es bilden sich Wassertropfen, die wir als Wolken sehen und schliesslich fallen Niederschläge → Steigungsregen
Bei einem Ansteigen um 100 m rechnet man mit einer Abnahme der Durchschnittstemperatur von etwa ½ °C / die Jahrestemperatur beträgt in St. Gallen (664 müM) 6,9 °C, in Wildhaus (1115 müM) 5,8 °C und auf dem Säntis (2500 müM) -1,9 °C / umgekehrt sind die Niederschlagsmengen auf dem Säntis am höchsten
Durch das ganze Rheintal spürt man den Föhn bis zum Bodensee / er stürzt mit grosser Geschwindigkeit von den Alpen durch die nach Norden geöffneten Täler in die Tiefe / dabei trocknet er aus und erwärmt sich stark / im Frühling beschleunigt er die Schneeschmelze / er begünstigt auch den Anbau von landwirtschaftlich hochwertigen Produkten
Kanton St. Gallen Topografie / Geologie
Entstehung der Alpen
In der Jura- und Kreidezeit vor >150 Mio Jahren lag der Alpennordrand in einer vom Meer überfluteten Senke / mächtige Kalk-, Mergel- und Sandsteinschichten lagerten sich darin ab / diese zu Tafeln verhärteten Schichten zerbrachen unter einem von Süden her wirkenden Druck in der Erdrinde / die Schichten wurden dabei verfaltet und überschoben sich nach Norden / gleichzeitig drang aus den Rissen und Klüften Magma aus dem Erdinnern und erstarrte auf dem Meeresboden / die Faltung des von Süd nach Nord gerichtete Druckes zeigt sich heute in hintereinander liegenden, unterschiedlich grossen Gebirgsketten / sie ziehen sich ungefähr von Ost nach West
Durch das Zusammenschieben wurden die Gesteinsmassen angehoben / dieser Vorgang begann im Tertiär vor ca. 60 Mio. Jahren / mit dem Aufsteigen des Gebirgswalles setzten gleich auch Verwitterung und Abtragung ein / im damaligen feuchten und heissen Klima vermochten die Flüsse ungeheure Schuttmassen aus den sich bildenden Alpen ins Mittelland hinauszutragen / dort häuften sich die Gerölle zu mächtigen Schuttkegeln aus Molasse (Kalk, Mergel, Sandstein) an / auf einer weichen Unterlage wie dem Flysch, konnten die Gesteine leicht bis zur mächtigen Molasse des heutigen Mittellandes vorwärts gleiten
Die St. Galler Alpen sind aus Decken aufgebaut / das sind Gesteinspakete, die sich als Platten oder Faltungen auf einer fremden Unterlage überschoben haben / die helvetischen Decken schoben sich über das Gotthardmassiv nordwärts / hier fuhren sie auf die Nagelfluhmassen, welche die Alpenflüsse angeschwemmt hatten / sie zerbrachen sie zu Platten und schoben sie vor sich her / dabei kippten die Molasseplatten gegen Süden ein, sodass sie sich gegen Norden steil schief stellten
Auf dem ungleichmässigen Untergrund zerbarsten die spröden Kalkfalten / die einen Massenteile wurden an Widerständen abgebremst und emporgehoben / andere wiederum konnten sich weit und wenig gehindert gegen Norden zu bewegen / so ist das Alpsteingebirge durch eine Unzahl von Brüchen und Verwerfungen gegliedert / welche die einzelnen Falten quer durchsetzen / besonders eindrücklich ist der Sax-Schwendi-Bruch von der Saxerlücke über Bollenwees und Bogartenlücke bis Wasserauen
Schroffe steile Felsen deuten auf hartes Gestein hin / die Churfirsten bildeten sich bspw. aus Kalken der Jura- und Kreidezeit / und weil die tektonischen Schichten das Relief sehr stark beeinflussten, entstanden die nach Norden gegen das Toggenburg sich senkenden Bergrücken durch die in gleicher Richtung einfallenden Schichten der Säntisdecke
Sowohl Alpstein wie auch Churfirsten bestehen aus Sedimentgesteinen / diese sind im Mesozoikum während der Kreideperiode im Meer abgelagert worden / das Material ist dann bei der Alpenfaltung während der Tertiärzeit in einem riesigen Schichtkomplex hierher verschoben worden / die Schichtung von unten nach oben besteht abwechselnd aus Mergel, Kalkstein und Sandstein
Das Säntisgebirge und der Hohe Kasten bestehen aus hartem Kreidekalk / tonige und mergelige Schichten aus Flysch bilden dagegen hügelige Landschaftsformen / er liegt bspw. in der Talmulde des Toggenburgs, im Gebiet der Tamina und im Weisstannental
Als besonders widerstandsfähiges und hartes Gestein gilt der Appenzeller Granit / er liegt in einer Molassenschicht auf der Linie: Abtwil – Toggenburg – Zürcher Oberland (ZH) – Sihltal (ZH) / er besteht aus dunklen Kalken und Dolomiten
Formung der Alpen
Im voralpinen Raum des Kt. St. Gallen ist die Nagelfluh das vorherrschende Gestein in der Molasse / sie wurde durch Flüsse aufgeschüttet, die aus Graubünden nach Norden flossen / die vordringenden helvetischen Decken übten auf die Molasseschichten einen grossen Druck aus / diese wölbten sich, zerbrachen und schoben sich in einzelnen Schollen übereinander → subalpine Molasse / diese zusammen- und übereinander geschobenen Schichtpakete sind in der Landschaft als Rippen erkennbar
In den Gebirgsketten gibt es Verschiebungen, Fugen und Brüche / der grösste Querbruch läuft von Sax im Rheintal nach Schwende (AI) / entlang der Alpsteinketten haben sich die voneinander getrennten Bergketten in horizontaler und senkrechter Richtung gegeneinander verschoben / östlich des Hohen Kastens verlaufen parallel zum Rheintal verschiedene Brüche / den Bruchfugen entlang ist das heutige Rheintal als Graben in die Tiefe gesunken / die angrenzenden Gesteinsmassen haben sich zu Gebirgen aufgewölbt / Rheintal = Grabenbruch
Das bekannteste Bergsturzgebiet im St. Galler Rheintal ist der Schlosswald in der Gde Sennwald / hier stürzten grosse Felsmassen vom Stauberenfirst ins Tal und bedeckten >4 km2 / heute ist ein Grossteil der Bergsturztrümmer von Rheinschutt überdeckt / der Rest bietet eine Hügel- und Buckellandschaft in der sonst ebenen Talmulde
Gletscher
Während der Eiszeit vor ca. 1 Mio. bis _ Jahren vChr. stiessen mehrere Gletscher mehrmals aus den Alpentälern ins Alpenvorland hinaus und zogen sich dann wieder zurück / in den Gebieten der Alpen und Voralpen verwitterten durch die Sprengwirkung des Frostes grosse Gesteinsmassen / diese wurden als Trümmer durch die Gletscher oder dessen Schmelzwasser ins Voralpenland hinausgetragen / dabei schliffen die Gletscher ihre Unterlage ab, füllten Spalten und Löcher und weiteten die V-Täler zu U-Tälern aus
Für das Gebiet des Kt. St. Gallen war der Rheingletscher der bedeutendste / er stiess aus Graubünden durch das Rheintal nach Norden vor / ein Seitenarm drückte über den Kunkelspass und durch das Taminatal bis nach Bad Ragaz / in Sargans bog vom Hauptstrom ein Abzweiger nach Westen durch das Walenseetal / in der Linthebene vereinigte sich dieser Strang mit dem Linthgletscher
Ein anderer Teil schob sich ins Toggenburg und verschmolz dort mit dem Säntisgletscher / gemeinsam zwängten sie sich durch das ganze Thurtal bis in die Gegend von Wil / dort trafen sie wieder auf den Rheingletscher / dieser bewegte sich bis zum Bodensee und breitete sich von da in alle Richtungen aus
Wo die Gletscher aus den Alpentälern in die Ebene austraten, entstanden Hügel mit ovalem Grundriss → Drumlins / ihre Längsachse verläuft parallel zur Fliessrichtung der ehemaligen Gletscher / sie bestehen aus Moränenmaterial, das durch Schründe und Spaltungen durch das Eis des nicht mehr so mächtigen Gletschers auf den Grund gelangt ist / eine solche Landschaft liegt auf der Linie: Wittenbach – Häggenschwil – Waldkirch – Niederbüren
Gewässer
Die Quelle der Linth liegt auf 1’029 müM / vom Einsetzen der Schneeschmelze im Frühling bis in den Hochsommer nimmt die Wassermenge stetig zu / das Gefälle und damit die Transportkraft des Wassers ist im oberen Bereich entsprechend gross, in der Linthebene aber gering / deshalb lagerten sich hier grosse Kies- und Schottermengen ab / diese versperrten dem abfliessenden Wasser den Weg, so dass sich der Fluss in verschiedne Arme aufteilte
Die erste Gewässer-Korrektion erfolgte 1811 durch Alfred Escher / seither nimmt die Linth ihren Weg vom Glarnerland durch den Escherkanal in den Walensee und lagert das Geschiebe dort ab / 1816 wurde dann der 17,8 km lange Linthkanal vom Walensee zum Zürichsee eröffnet / diese Flusskorrektion ermöglichte die Melioration der Ebene
Die gleiche Situation findet sich auch beim Rhein / Dörfer und Felder wurden immer wieder überschwemmt / 1882-84 wurden die Seitenbäche des Rheins im Werdenberger Binnenkanal gesammelt und bei Rüthi in den Rhein geleitet / 1906 erfolgte die Fortsetzung, der Rheintaler Binnenkanal bis St. Margrethen / es galt, die Geschiebeablagerung im Rhein zu reduzieren / seit 1900 fliesst nun der Rhein durch ein künstliches Bett von St. Margrethen über Fussach [A] direkt in den Bodensee / 1923 wurde auch die Flussschleife bei Diepoldsau durch einen künstlichen Durchstich abgeschnitten
Die Thur hat eine sehr unregelmässige Wasserführung / nach Regenfällen und heftigen Gewittern schwillt sie rasch an und wird zu einem reissenden Strom

picswiss.ch/Roland Zumbühl